Presseschau April 2004
Die Presseschau
ist ein Service des durch entimon geförderten Projektes respectabel.de
Hier finden Sie eine Auswahl unserer Redaktion
von Artikeln des täglichen Pressespiegels
Donnerstag,
1. April 2004
Straßburg - Die Zahl antisemitisch motivierter Handlungen ist in der Europäischen Union in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Dies geht aus einem Bericht der Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit hervor. Besonders dramatisch sei die Entwicklung in Deutschland gewesen. Dort sei die Zahl antisemitischer Handlungen von 1999 bis 2000 um 69 Prozent gestiegen. 2002 habe es zwar einen leichten Rückgang gegeben, doch nahmen die Gewalttaten gegenüber dem Vorjahr von 18 auf 28 zu. Die Täter seien in der EU vor allem junge Rechtsextreme weißer Hautfarbe. dpa
Donnerstag, 1. April 2004
taz: Salomon Korn, der Vizepräsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, hat kürzlich während der Leipziger Buchmesse gesagt, dass mit der EU-Osterweiterung eine neue Welle des Antisemitismus Europa bedrohe. Übertreibt Herr Korn?
Wolfgang Benz: Eher nicht. Antisemitismus ist in Osteuropa salonfähig und die Sorge vor dem Antisemitismus der neuen EU-Mitglieder ist berechtigt. Das hat sich in den dreizehn Jahren seit der Wende durch Äußerungen osteuropäischer Politiker reichlich bewiesen.
Manche baltischen Zeitungen sind offen antisemitisch, manche polnischen Politiker stellen sich taub. Womit hat das zu tun?
Antisemitismus dient ja immer zur schlichten Welterklärung. Damit kann man sich die Leiden in den sowjetisch besetzten und dominierten Ländern erklären. Man macht es sich einfach und sagt: Die Juden waren schuld. Denn die hätten den Kommunismus in die Welt gebracht, weil ja viele führende Kommunisten Juden gewesen seien. Das ist der gleiche Unsinn, den der CDU-Abgeordnete Martin Hohmann kürzlich verzapfte.
Seit wann dient in Osteuropa der Antisemitismus als Erklärung für gegenwärtige Missstände?
Erstaunlich ist, dass zum Beispiel in Russland, in Weißrussland und in der Ukraine der christliche Antijudaismus nach 1989 einfach wiederbelebt werden konnte - als seien 70 Jahre Kommunismus spurlos verschwunden. Dies steht in einer bestimmten Tradition der esoterisch-mystischen Welterklärung - und es ist kein Zufall, dass jetzt dort auch wieder die "Protokolle der Weisen von Zion", ein antisemitischer Klassiker, wieder erhältlich sind. Da wird in die ganz alten Arsenale der Judenfeindschaft gegriffen. Damit sperrt man sich gegen rational-westliches Denken. Das ist eine spezifisch russische Variante, in der der Antisemitismus eine große Rolle spielt.
Und die hat in den Jahren der russischen Dominanz auf Osteuropa abgefärbt?
Nicht nur. In Polen gibt es einen autochthonen katholisch unterfütterten Antisemitismus. In den baltischen Ländern wird der Antisemitismus jetzt zum russischen Import erklärt. Aber jeder arbeitet gerne mit Schuldzuweisungen an die Juden, nur möchte man nicht den Eindruck erwecken, diese selbst erfunden zu haben.
Wer formuliert denn die öffentlichen Schuldzuweisungen an Juden?
Die orthodoxe Kirche hat nach der Wende beträchtlichen Einfluss gewonnen. Und wenn der Pope sagt, "Die Juden sind böse, weil sie Jesus ans Kreuz geschlagen haben", dann prallt eine staatliche und schulisch betriebene Aufklärung daran ab. Die christlichen Kirchen müssen in diese Verantwortung für ein westlich demokratisches Denken mit einbezogen werden.
Wo genau sehen Sie da Verantwortlichkeiten?
Im Weltkirchenrat und in der europäisch-kirchlichen Zusammenarbeit steckt ein wesentliches Arbeitspotenzial, das genutzt werden muss. Die christlich-jüdische Verständigung hier im Westen ist eine sehr schöne Sache.
Aber die katholischen und protestantischen Amtsträger müssen dem orthodoxen Amtsbruder klarmachen, dass er diese entsetzlichen Welterklärungen, bei denen die Juden die Schuldigen an allem Weltübel sind, unterlassen muss.
Viele Osteuropäer meinen, dass Stalin schlimmer war als Hitler. Beinhaltet das Ihrer Ansicht nach eine unzulässige Relativierung des Holocaust? Oder sogar ein antisemitisches Ressentiment?
Nein, die gemeinsame Geschichtsdeutung hat damit nicht viel zu tun. Etwas überspitzt gesagt, würde ich so weit gehen und es dem Ukrainer überlassen, ob er Stalin schrecklicher als Hitler findet. Darum geht es nicht. Die antisemitischen Traditionen in Russland reichen weit bis in den Zarismus zurück, im Baltikum bis tief ins 19. Jahrhundert. Dort wurzelt die Tradition der Ausgrenzung und Schuldzuweisung, die sich an religiösen, kulturellen und sozialen Kategorien festmacht. Diese Traditionen sind völlig unabhängig von der Frage, wie man Hitler und Stalin bewertet.
Es spielt also keine Rolle, ob man der Totalitarismustheorie anhängt und Kommunismus mit dem Nationalsozialismus gleichsetzt. Oder wie immer man sich Geschichte auf simple Weise erklären mag. Wir haben es beim Antisemitismus mit einem Phänomen weit älterer Art zu tun.
Viele Juden befürchten - wie Salomon Korn -, dass der Westen diesen, wie Sie sagen, alten osteuropäischen Antisemitismus achselzuckend hinnimmt. Besteht die Gefahr, dass die europäischen Juden mit diesem Problem allein gelassen werden?
Sie haben keine Gewissheit. Aber es gibt die unbedingte Hoffnung darauf, dass sich dieses Europa als eine demokratische Völkergemeinschaft nach parlamentarisch-demokratischen, liberalen und menschenfreundlichen Spielregeln versteht.
Daher muss Antisemitismus, wo immer er auftritt, sanktioniert werden. In diesem erweiterten und vergrößerten Europa ist dies ein Auftrag der westlichen Länder gegenüber den östlichen, genau dafür zu sorgen. Aber den hier lebenden Juden kann man die Furcht, allein gelassen zu werden, nicht so ohne Weiteres nehmen. "INTERVIEW:
ADRIENNE WOLTERSDORF
Donnerstag, 1. April 2004
Antisemitismus
"Die Hemmschwelle
wird niedriger"
Die Hemmschwelle zur Äußerung antisemitischer Klischees wird nach Ansicht
des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland immer niedriger. Er
bedauere, dass er mit seinen Forderungen nach stärkerer Bekämpfung von Antisemitismus
und Fremdenfeindlichkeit auf wenig Resonanz stoße, sagte Paul Spiegel.
Osnabrück
- "Dieses Problem wird bestehen bleiben, so lange die Bevölkerung die Bekämpfung
des Rechtsradikalismus und Antisemitismus nicht als ihr ureigenstes Thema betrachtet",
sagte der Zentralratspräsident in der heutigen Ausgabe der "Financial Times
Deutschland". Nach wie vor gebe es in Deutschland einen von Wissenschaftlern
festgestellten antisemitischen Bodensatz von 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung.
Es sei falsch, juden- und fremdenfeindliche Tendenzen lediglich als Angriffe
auf Minderheiten zu betrachten, die die Mehrheit in der Gesellschaft nichts
angehe. Unter dem nationalsozialistischen Holocaust habe schließlich die gesamte
Bevölkerung gelitten, betonte Spiegel. Er verwies darauf, dass zwischen 1933
und 1945 auch Millionen von Andersgläubigen ihr Leben gelassen haben.
Die Veranstaltung im Bundestag zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar zeige "kaum
Außenwirkung", beklagte Spiegel. Er forderte, alle Schüler sollten sich
an diesem Tag wenigstens eine Stunde mit dem Thema beschäftigen "nicht
aus Schuldgefühl, sondern aus Verantwortung dafür, dass so etwas wie der Holocaust
nie wieder passiert".
Freitag, 2. April 2004
Juden- und fremdenfeindliche Tendenzen sind nach Ansicht von Paul Spiegel, Präsident des Zentralrats der Juden, nicht nur Angriffe auf Minderheiten. Sie gingen auch die Mehrheit an, sagte Spiegel der Neuen Osnabrücker Zeitung. Auch unter dem nationalsozialistischen Holocaust habe die ganze deutsche Bevölkerung gelitten. (epd)
Mittwoch, 7. April 2004
Konkrete Schritte zur Bekämpfung des Antisemitismus in all seinen Formen will eine internationale Konferenz Ende April in Berlin vereinbaren. Die Konferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) findet auf Einladung der Bundesregierung am 28. und 29. April im Auswärtigen Amt statt. Bundespräsident Johannes Rau werde die Konferenz eröffnen und Außenminister Joschka Fischer die deutsche Delegation leiten, teilte das Auswärtige Amt am Dienstag weiter mit. Die OSZE und Deutschland wollten ein Zeichen setzen, dass sie das Problem des Antisemitismus und die Sorgen der jüdischen Gemeinden ernst nähmen. Erwartet werden rund 500 Teilnehmer aus allen 55 OSZE-Mitgliedstaaten. Neben Regierungsvertretern nehmen auch nichtstaatliche Organisationen teil. DPA
Dienstag, 13. April 2004
Unbekannte haben ein Mahnmal der Jüdischen Gemeinde zu Berlin mit Nazi-Symbolen beschmiert. Ein Zeuge verständigte am Samstag die Polizei. Die Funkstreife stellte dann fest, dass ein Hakenkreuz und SS-Runen auf das Mahnmal gesprüht waren. Die Entfernung der Schmiererei wurde veranlasst. Der Staatsschutz ermittelt. (dpa)
Dienstag, 13. April 2004
Leipzig - Die Richter des Leipziger Verwaltungsgerichts haben Anfang Mai einen außergewöhnlichen Ortstermin. Sie besichtigen das ehemalige Israelitische Altersheim in der Hinrichsenstraße 14, ein mondäner Dreigeschosser. Nach der Wende wurde die Israelitische Religionsgemeinde wieder Eigentümer des kleinen Anwesens im gutbürgerlichen Waldstraßenviertel. Die Gemeinde will das Haus zu einem Begegnungszentrum ausbauen.
Ein Bauschild kündigt seit zwei Jahren die Sanierung an, die Stadt Leipzig und der Freistaat Sachsen wollen das Projekt mit 3,8 Millionen Euro unterstützen. Doch Handwerker sind bislang nicht angerückt. Denn einige Nachbarn stellen sich quer. Sie wollen den Um- und Ausbau des leer stehenden Hauses auf dem Klageweg verhindern. Ihr Einwand: Es wachse die Gefahr von Anschlägen, das jüdische Zentrum sei ein Risiko für die Sicherheitslage. Seither haben die Richter das Wort. In einem Eilverfahren wies zwar das Verwaltungsgericht die Einwände der Nachbarn zurück. Doch die Antragsteller legten Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ein.
In der Leipziger Bevölkerung gibt es eine breite Solidarität mit der jüdischen Gemeinde, seit der Pfarrer der Thomaskirche, Christian Wolff, die Affäre öffentlich machte. Der Pastor warf den Klägern vor, sie bewegten sich "in einer trüben Tradition des Antisemitismus". Bei einer Anwohner-Versammlung des ambitionierten "Bürgervereins Waldstraßenviertel" stärkten mehr als 300 Leipziger der Israelitischen Gemeinde den Rücken, 1000 Menschen beteiligten sich an einer Unterschriftenaktion, die Stadtratsfraktionen starteten eine Initiative für den Bau und Oberbürgermeister Wolfgang Tiefensee (SPD) erklärte: "Die Bürgerschaft Leipzigs hat eine Bringeschuld gegenüber ihren jüdischen Mitbürgern. In der Nazizeit haben auch Leipziger weggeschaut, wenn Juden verfolgt wurden."
Mittwoch, 14. April 2004
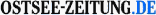
|
„Holocaust
im Comic“ kommt nach Wolgast |
|
|
Wolgast Die Vereine „Bunt statt Braun“ sowie „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ laden für den 4. Mai ab 17 Uhr ins historische Wolgaster Rathaus ein. Hier wird die Ausstellung „Holocaust im Comic“ eröffnet, die vom 5. bis 13. Mai zu sehen sein wird.
Hinter der zunächst unpassend scheinenden Verknüpfung von Holocaust und Comic steht die sehr ernsthafte Auseinandersetzung mit der Historie der massenhaften Tötung von Juden sowie mit verstecktem und offenem Antisemitismus in heutigen Comics. Dabei wird unter anderem der Frage nachgegangen, wie weit schwarzer Humor eigentlich gehen darf.
Die Veranstalter hoffen insbesondere, dass viele Schulklassen aus Wolgast und Umgebung den Besuch der Ausstellung in den Unterricht einbeziehen. Anmeldungen von Klassen sind möglich unter Tel.: 038371 / 2 83 21 oder 0172 / 9 58 47 68.
Donnerstag,
15. April 2004
VON SVEN VON REDEN
Birkenau ist ein schöner Name für einen grausamen Ort. Auf dieser "Birkenwiese" stand eines der Hauptlager von Auschwitz, in dem hunderttausende vergast wurden. Heute wächst zwischen den Baracken friedlich das Gras. Anouk Aimée sitzt neben einem der lang gezogenen Gebäude und pisst: "Das ist mein Zuhause, ich mache hier, was ich will", ruft sie unwirsch einem jungen Mann entgegen, der sie entsetzt beobachtet.
Aimée spielt in "Birkenau und Rosenfeld" eine Überlebende des Konzentrationslagers, die nach über 50 Jahren an den Ort zurückkommt, um sich ihren Erinnerungen zu stellen. Sie bricht durch einen Zaun in das Lager ein, als wolle sie diesmal die Art ihres Eintritts selber bestimmen und sich des Ortes nach ihren Maßgaben bemächtigen. So lässt sich auch ihr Urinieren verstehen: Es ist Ausdruck der Inbesitznahme wie der Entweihung des Orts.
Schon diese zwei Szenen verdeutlichen, dass sich "Birkenau und Rosenfeld" nur schwer in eine Typologie des Schoah-Films zwängen ließe. In den letzten Jahren gab es vor allem zwei Perspektiven in Filmen über den Holocaust: Die Spielfilme stellen zwar die Opfer in den Vordergrund, versuchen aber nicht, das Sterben in den Lagern realistisch darzustellen. Niemand will sich anmaßen, das Grauen filmisch abbilden zu können - in Roberto Benignis "Das Leben ist schön" reicht ein angedeuteter Leichenberg als Symbol für die Vernichtungspolitik. Der Anspruch auf Authentizität bleibt Dokumentationen vorbehalten, allen voran den Filmen der Shoah Visual History Foundation, die sich auf Aussagen der noch lebenden Opfer konzentrieren - ein Versuch, das Erinnern lebendig zu halten, bevor die letzten Überlebenden sterben.
"Birkenau und Rosenfeld" fällt zwischen beide Ansätze: Es ist zwar ein fiktionaler Film, er spielt aber ausschließlich in der Gegenwart. Dokumente körperlichen Leids aus der Gedenkstätte werden nicht gezeigt. Thematisch ist er eher den Filmen der Shoah Foundation verwandt: Regisseurin Marceline Loridan-Ivens, Witwe des Dokumentarfilmers Joris Ivens, ist selber Überlebende des Lagers Birkenau. In Jean Rouchs essayistischem Dokumentarfilm "Chronik eines Sommers" (1961) sprach sie darüber. In einer unvergesslichen Szene streifte sie über die Pariser Place de la Concorde, vertieft in ein Zwiegespräch mit ihrem in Auschwitz ermordeten Vater. Kurz zuvor erklärte sie afrikanischen Austauschstudenten beim Mittagstisch, was die Tätowierung auf ihrem Arm bedeutete: "Nein, meine Telefonnummer ist das nicht."
Ihr eigener Film stellt einen Versuch dar, Erinnerungen lebendig zu halten. Es geht der Regisseurin allerdings weniger um den Inhalt dieser Erinnerungen, sondern darum, "der Suche im Erinnern seinen Stellenwert einzuräumen".
Ein Vorhaben, das schwierig visuell zu vermitteln ist. Loridan-Ivens will "die Präsenz des Ortes unerträglich werden lassen", bis zu dem Punkt, an dem die Erinnerung an das, was geschehen ist, "von den Bildern kommt und nicht von den Worten". Das gelingt in Szenen wie den anfangs beschriebenen. Doch die Regisseurin kommt natürlich nicht umhin, auch auf Worte zurückgreifen: Ihr Alter Ego Anouk Aimée streift durch die Lager, spricht mit sich selber und freundet sich nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Enkel eines SS-Schergen an, der den Ort mit seinem Fotoapparat zu begreifen sucht. Das sind Kunstgriffe, um das Erinnern und die Suche danach von außen begreifbar zu machen.
40 Jahre hat sie gebraucht, bis sie sich dazu in der Lage sah, das Drehbuch für "Birkenau und Rosenfeld" zu schreiben. Und man merkt dem Film in jeder Szene an, wie schwer der Regisseurin die Dreharbeiten fielen, aber auch, dass sie ihn machen musste. Es ist ein sehr persönlicher Film, der Menschen, die keine schwer traumatisierenden Erlebnisse hinter sich haben, wenig Einstiegshilfen bietet - und diese auch gar nicht bieten will. Am Ende bleibt das unheimliche Bild von harmonisch wogendem hüfthohem Gras vor den steinernen Symbolen des Terrors.
"Birkenau und Rosenfeld". Regie: Marceline Loridan-Ivens. Mit Anouk Aimée, August Diehl, Claire Maurier u. a. Frankreich 2002, 90 Min.
Freitag,
16. April 2004
Eine rapide Zunahme an antisemitischen Äußerungen haben gestern Vertreter mehrere Initiativen beklagt und gleichzeitig eine neue Broschüre vorgestellt. Herausgegeben von der Amadeu Antonio Stiftung in Berlin, der Regionalen Arbeitsstelle für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule e. V. (RAA) und dem Klett Verlag soll sie vor allem an Schulen zum Einsatz kommen.
Bedenklich sei nicht nur die Zunahme von Antisemitismus, erklärte Anetta Kahane von der Amadeu Antonio Stiftung. Die aktuelle Judenfeindlichkeit stehe zudem oft in neuem Zusammenhang. Die neue Broschüre kläre über diese auf: "Nicht nur im Zusammenhang mit einer Israel-Kritik wegen des Nahost-Konflikts, sondern auch aus den Reihen der Globalisierungsgegner kommen solche Äußerungen."
Hier gebe es zudem enge Verbindungen zu einem Antiamerikanismus, erklärt Harald Weber, Redakteur der Broschüre: "Es sind die gleichen Stereotypen, die da auftauchen: Gier nach Geld, Anstreben der Weltherrschaft, was man Juden als auch Amerikanern unterstellt." Dem Antiamerikanismus ist daher ein eigener Themenblock gewidmet.
Ein weiteres Thema des Heftes sind Codes des Antisemitismus in der Jugendkultur. "Es gibt sogar Verbrüderungen von Rechtsextremen mit Islamisten", sagte Kahane, selbst bei rechten Demonstranten seien schon Palästinensertücher aufgetaucht. Schon die Tabuisierung des Themas "Juden" in der DDR habe nach der Wende Antisemitismus hervorgerufen. Deshalb ist ein Schwerpunkt auch diesem Thema gewidmet.
"Wir wollen die aktuellen Tendenzen in Handlungsanleitungen verpacken", erklärt Britta Kollberg von der RAA. Viele Lehrer seien bei dem Thema verunsichert und wüssten nicht, was sie von den neuen Strömungen halten sollen. Daher könnten sie auf entsprechende Fragen ihrer Schüler kaum kompetent antworten. Tauchten solche Fragen auf, könne man als Lehrer die Broschüre bestellen und habe sie schon am übernächsten Tag - das sei gewährleistet.
Kollberg betonte, dass die Broschüre aber nicht nur für Schulen, sondern auch für die öffentliche Verwaltung und die Polizei vorgesehen sei. Interessierte Bürger könnten sie ebenfalls bestellen. " CHRISTIAN VATTER
Die Broschüre: "Bulletin" kann beim Klett-Verlag bestellt werden und kostet 7,50 Euro. Informationen im Internet unter www.klett-verlag.de
Freitag, 16. April 2004
Die Jüdische Gemeinde in Berlin erinnert am
Sonntag an den 61. Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Ghetto und an die
Opfer des Holocaust. Die Gedenkrede werde der Direktor des Centrum Judaicum,
Hermann Simon, halten, teilte die Gemeindeleitung am Donnerstag mit. Zudem solle
der Berliner Unternehmer Hans Wall für seinen "mutigen Kampf gegen Rassismus,
Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit" mit dem Heinrich-Stahl-Preis 2004
ausgezeichnet werden. Anschließend sollen die Namen der 55 696 ermordeten
Berliner Juden verlesen werden.
Die Lesung werde mehr als 24 Stunden dauern,
hieß es. Der undotierte Heinrich-Stahl-Preis war 1954 vom damaligen Vorsitzenden
der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Heinz Galinski, angeregt worden. Er trägt
den Namen des letzten Gemeindevorsitzenden in der NS-Zeit und wird an Persönlichkeiten
verliehen, die zur Verwirklichung von Demokratie, Toleranz und Humanität beigetragen
haben. Der Stadtmobiliarhersteller Wall unterstützt in Berlin zahlreiche Projekte
zur Erinnerung an den Holocaust.
Während des Aufstandes im Warschauer Ghetto
von Januar bis Mai 1943 wehrten sich rund 1100 der insgesamt 60 000 damals
noch dort lebenden Juden gegen den Abtransport in die nationalsozialistischen
Vernichtungslager. epd
![]()
Nikolaus Bernau
Wer nach Israel fährt,
hört immer wieder: Die Europäer lassen uns alleine, die Situation ist wie 1933,
als Juden Angst haben mussten, sich öffentlich zu zeigen. Jetzt wurde aus Sicherheitsgründen
die jährliche Verlesung der Namen jener Berliner Juden, die unter den Augen
ihrer Nachbarn deportiert und ermordet wurden, vom Wittenbergplatz in den Vorhof
des Gemeindezentrums an der Fasanenstraße verlegt. Wenn das erst einmal bekannt
geworden ist, wird es schwierig zu sagen, mancher in Israel leide an Verfolgungswahn.
Von Sonntag um 19.30 Uhr
bis voraussichtlich Montag gegen 24.00 Uhr soll der 55 696 ermordeten Berliner
gedacht werden. Die Ängste der Jüdischen Studentengemeinde vor den Nachtstunden
sind ernst zu nehmen, vor zwei Tagen wurde in Budapest ein Attentat auf das
neue Holocaust-Museum verhindert, und auch in Berlin nehmen antisemitische Schmierereien
und Drohungen zu. Doch gerade deswegen sollte die Lesung unbedingt auf dem Wittenbergplatz
stattfinden. Es geht darum, sich an die Seite der jüdischen Berliner zu stellen,
mit ihnen zu gedenken und zu trauern. Kosten für Polizisten dürfen nicht zählen:
Auch eine arme Stadt muss einer solchen Kundgebung Ruhe und Würde im öffentlichen
Raum garantieren.
Juden häufiger Opfer von Gewalttaten
Allerdings sinkt Gesamtzahl antisemitischer Delikte / NPD verliert trotz
gescheitertem Verbotsverfahren Mitglieder
Berlin. Die Sicherheitsbehörden haben 2003 einen deutlichen Rückgang
antisemitischer Delikte registriert. Es seien 20 Prozent weniger Straftaten
festgestellt worden, die sich gegen Juden und jüdische Einrichtungen richteten,
sagten Sicherheitsexperten dem Tagesspiegel. Die Gesamtzahl lag unter 1300 Taten,
2002 waren es 1594. Einen endgültigen Wert für 2003 gibt es noch nicht, Bundeskriminalamt
und Bundesamt für Verfassungsschutz befinden sich aber in der Endphase der Auswertung
aller Daten, die von den Polizeien der Länder geliefert wurden.
Grund für die Abnahme antisemitischer Delikte ist nach Ansicht von Sicherheitsexperten:
2003 habe ein „Fanal“ gefehlt, das so stark wirkte wie die monatelange Affäre
2002 um die antijüdischen Äußerungen des FDP-Politikers Jürgen Möllemann, der
im Juni 2003 in den Tod stürzte. Diese hätten zahlreiche Straftaten provoziert,
insbesondere Propagandadelikte. Die Affäre um den CDU-Bundestagsabgeordneten
Martin Hohmann, der im Oktober 2003 über Juden als „Tätervolk“ räsonnierte,
habe die Emotionen weniger angefacht als Möllemanns Attacken.
Von Entwarnung ist allerdings keine Rede. Die Behörden registrierten eine Zunahme
antijüdischer Gewalttaten: 2003 waren es 35, nach 28 im Jahr 2002 und 18 im
Jahr 2001. Mit zwölf antisemitischen Gewalttaten, die sich in Berlin ereigneten,
wurde ein Drittel in der Bundeshauptstadt verübt. In Berlin ist außerdem der
wachsende Anteil nichtdeutscher Täter auffällig: Ausländer, vor allem jüngere,
begingen die Hälfte aller antisemitischen Straftaten (Gesamtzahl 2003: 171).
Bei den rechtsextremistischen Straftaten bundesweit stellen die Behörden einen
Rückgang auf etwa 10 500 fest (2002: 10 902). Die Zahl der Gewalttaten (2002:
772) bleibe allerdings „stabil“, heißt es in Sicherheitskreisen. Das Potenzial
der gewaltbereiten Rechtsextremisten, vornehmlich Skinheads, sei aber geschrumpft
(2003: 10 000, 2002: 10 700). Im Gegenzug verzeichneten die Neonazis, meist
organisiert in 160 „Kameradschaften“, einen Zuwachs (2003: 3000, 2002: 2600).
„Die Szene verfestigt sich“, sagte ein Experte. Es gebe einen Übergang „von
subkulturellem Denken zu Neonationalsozialismus“. Die ideologische Verhärtung
zeige sich auch im Internet, wo deutsche Rechtsextremisten 910 Homepages präsentieren
und sich die Szene in zahlreichen Chatrooms und Foren tummelt. Außerdem versammelten
sich Neonazis 2003 wieder zu mehr als 60 Aufmärschen (2002: 68). Eine Terrorstruktur
gebe es trotz der Fanatisierung nicht. Der von Neonazis in München geplante
Anschlag auf die Baustelle des jüdischen Gemeindezentrums sei „singulär“. Nach
Angaben des bayerischen Innenministers Günther Beckstein soll das Attentat mit
Hilfe des „großen Lauschangriffs“ verhindert worden sein.
Die Behörden beunruhigt zudem der „Erfolg“ des rechten Musikbusiness. Über die
Szene hinaus gebe es in der Jugend eine „große Aufnahmebereitschaft“ für Hass-CDs,
sagt ein Experte. 2003 kamen mehr als 100 CDs neu auf den Markt, die Zahl der
einschlägigen Musikvertriebe stieg auf 54 (2002: 50). Außerdem wurden mehr als
100 rechtsextreme Konzerte registriert (2002: 112).
Im Gegensatz dazu sehen rechtsextreme Parteien alt aus. Die „Republikaner“ haben
noch 8000 Mitglieder (2002: 9000), die DVU 11 500 (13 000) und die NPD schrumpfte,
trotz des überstandenen Verbotsverfahrens, auf 5000 (6100). Frank Jansen
Das Risiko, Jude zu sein
ANTISEMITISMUS
Von Frank Jansen
Es gehört zum Alltag in Deutschland, dass Synagogen von Polizisten mit Maschinenpistolen
bewacht werden müssen. Und prominente Juden besonderen Schutz benötigen. Dass
ein Teil der Jugend die Musik kahlköpfiger Bands konsumiert, die in ihren Texten
gegen Juden hetzen. Unter jungen Muslimen scheint es zum guten Ton zu gehören,
Hass auf „die Juden“ zu äußern. Und sich zu freuen über Selbstmordanschläge
extremistischer Palästinenser mit hohen Opferzahlen unter israelischen Zivilisten.
Jahr für Jahr werfen meist unbekannt bleibende Friedhofsschänder jüdische Grabsteine
um oder beschmieren sie mit Nazi-Symbolen. Zum Alltag der Juden in Deutschland
gehört die Angst.
In dieser Woche werden in Berlin Politiker, Publizisten und Wissenschaftler
bei Konferenzen der OSZE und der Nicht-Regierungsorganisationen über den Antisemitismus
beraten. Auch in Frankreich und anderen Ländern werden Juden, ihre Gebetshäuser
und Geschäfte attackiert. Der Hass tritt wellenförmig auf, derzeit scheint er
in Europa etwas abzuflauen. Dennoch sind die Konferenzen überfällig: als Signal
des Widerstands gegen den Hass auf Juden und die Gewöhnung daran. Wie stark
der Impuls sein wird, hängt auch vom Verlauf der Konferenzen ab. Wird es gelingen,
die Vielschichtigkeit der Bedrohung und die daraus resultierende Einzigartigkeit
des Antisemitismus zu verdeutlichen? Kein anderes Volk ist in den letzten 2000
Jahren derart diskriminiert, verfolgt und mit Pogromen überzogen worden. Selbst
nach dem Holocaust, dem bis heute unfassbaren Vernichtungswahn der Nazis, ist
der Antisemitismus nicht weltweit geächtet. Die Koalition der Ressentiment-Verfechter
ist außergewöhnlich breit und hartnäckig, ihre Allianz reicht von Rechtsextremisten,
Rechtspopulisten und linken Antizionisten über Islamisten sowie ihre Terroristen
bis hin zu muslimischen Staatsoberhäuptern – und schließt viele „normale“ Bürger
ein, die privat und halblaut „den Juden“ geldgieriges Weltmachtstreben unterstellen.
Das globale Bündnis der Unbelehrbaren glaubt, es habe ein ganz aktuelles Argument.
Die harte Politik der israelischen Regierung gegenüber den Palästinensern wird
als „Beweis“ angeführt für Behauptungen wie diese: „Die Juden“ wollten mit „den
Amerikanern“ den Nahen Osten beherrschen. „Die Juden“ oder „die Israelis“ agierten
wie die Nazis. Linke Friedensfreunde haben Scharon mit Hitler verglichen, zum
Beispiel bei der großen Berliner Demonstration vor dem Irakkrieg. En passant
werden damit das NS-Regime und der Völkermord an den Juden verharmlost.
Kritik an der Politik der israelischen Regierung ist notwendig, wie bei jeder
anderen Regierung auch. Doch die Argumente sind nur so weit legitim, wie sie
antisemitische Stereotypen meiden. Kein noch so harter Schlag des israelischen
Militärs rechtfertigt auch nur eine antisemitische Andeutung. Demokraten dürfen
sich da keine falsche Toleranz erlauben. Die Affäre um die antijüdischen Attacken
Jürgen Möllemanns, vor allem aber das lange Zaudern der FDP-Spitze, hat die
Sorge geweckt, in Deutschland könnte der Antisemitismus eine politische Aufwertung
erfahren. Die CDU hat nach der „Tätervolk“-Rede des Bundestagsabgeordneten Martin
Hohmann schneller und radikaler reagiert.
Die Antisemitismus-Konferenzen sind auch eine Aufforderung an die Gastgeber,
die Stärke der eigenen Abwehrkraft gegen den Antisemitismus zu prüfen. Laut
Umfragen hegen 15 bis 20 Prozent der Deutschen latent oder sogar explizit Ressentiments
gegen Juden. Hinzu kommt die offene Feindschaft in der wachsenden Gruppe muslimischer
Zuwanderer. Ein Alltag ohne Angst ist für die jüdischen Gemeinden wohl noch
lange eine Illusion.
![]()
Alexander Mäder
Mittwoch, 28. April 2004
![]()
JUDEN
Damir Fras
BERLIN, 26. April. Der Vizepräsident des Zentralrats
der Juden in Deutschland, Salomon Korn, hat davor gewarnt, dass der Antisemitismus
in der Europäischen Union nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsländer zunehmen
wird. "In den acht mittelosteuropäischen Staaten ist das Phänomen noch
nicht einmal im Ansatz aufgearbeitet", sagte Korn der Berliner Zeitung.
"Das antisemitische Potenzial in der EU wird damit größer werden. Der klassische
Antisemitismus in Osteuropa kann sich mit dem subtilen Antisemitismus vermischen,
der in Deutschland und anderen EU-Mitgliedsstaaten vorhanden ist." Korn
verwies darauf, dass etwa in den drei baltischen Ländern Lettland, Litauen und
Estland noch immer keine grundlegende Beschäftigung mit der Tolerierung der
Judenverfolgung während der Nazi-Herrschaft stattgefunden habe: "Die dort
eingesetzten historischen Kommissionen haben bis heute kein Ergebnis über das
Ausmaß der Kollaborationsverbrechen unter dem Nationalsozialmus und dem Kommunismus
vorgelegt."
Der Vizepräsident des Zentralrates appellierte
an die Teilnehmer der am Mittwoch in Berlin beginnenden Antisemitismus-Konferenz,
diese Gefahr nicht zu unterschätzen, sondern klar und deutlich zu benennen.
"Die Konferenz muss darauf hinweisen, dass es diese Gefahr gibt."
Vertreter von 55 OSZE-Staaten wollen am Mittwoch und Donnerstag in Berlin über
den Kampf gegen Antisemitismus in Europa beraten.
Korn forderte eine gesamteuropäische Langzeit-Studie: "Wir brauchen endlich Aufschluss darüber, wie stark die Ressentiments gegen Juden tatsächlich in der Bevölkerung verankert sind und welche Ausprägung dieser Antisemitismus in den einzelnen Gesellschaftsschichten hat." Diese wissenschaftliche Studie müsse mindestens über eine Generation hinweg fortgeschrieben werden, "damit wir nicht mehr andauernd mit abstrakten Umfragezahlen im Nebel stochern müssen", sagte Korn.
Mittwoch, 28. April 2004
![]()
|
Herr Singer, wird es immer riskanter,
als Jude in Europa zu leben? Die Risiken sind real. Wir werden mit
ihnen jeden Tag konfrontiert. Aber es wäre eine Übertreibung, wenn man
annehmen würde, dass das Leben riskanter sei als früher. Das liegt daran,
dass heute Regierungen auf Antisemitismus reagieren. Das darf man nicht
ignorieren. Dennoch ist der Antisemitismus heute
sehr präsent ... Aber es gibt jetzt Menschen, die sagen:
Wir tolerieren das nicht mehr, wir schauen nicht mehr weg, wir greifen
ein. Soll dieses Signal von der Berliner OSZE-Konferenz
über Antisemitismus ausgehen? Das geschieht bereits, weil hochrangige
Politiker wie Colin Powell, Joschka Fischer und viele andere daran teilnehmen,
unter ihnen Vertreter von gut 60 jüdischen Organisationen. Ich hätte nie
erwartet, dass so ein Signal ausgerechnet von Berlin ausgehen wird. Aus
der Stadt, in der einst bestimmt wurde, dass die Juden Untermenschen seien
und getötet werden müssten. Es gab auch schon andere Städte, in denen
Treffen zum Thema Antisemitismus stattfanden. Aber sie erzeugten nie so
viel Resonanz wie das Treffen hier in Berlin. Was ist die beste Strategie im Kampf
gegen den Antisemitismus? Eine Kombination von Polizeieinsatz,
Strafverfolgung und Erziehung. Man muss die jungen Leute bilden und die
alten Leute vor jenen schützen, die antisemitisch vorgehen. Wie bewerten Sie die jüngste Studie,
wonach 36 Prozent der Deutschen antisemitischen Aussagen zustimmen? Wenn es nur Gefühle sind, dann brauchen
wir neue Erziehungsinitiativen. Aber die Leute selbst haben nicht das
Recht dazu, diese Gefühle auszusprechen, um Hass hervorzurufen. Und sie
haben mit Sicherheit auch nicht das Recht, sie in Taten umzusetzen. Wie wollen Sie das verhindern? Wer Hass predigt, muss stärker als bisher
vom Gesetz verfolgt werden. Solche Dinge müssen laufend beobachtet und
- wenn es zu Gesetzesverstößen kommt - auch geahndet werden. Darum wird
es auf dieser Konferenz gehen. Wir fordern Maßnahmen gegen jene Leute,
die zu Hass aufrufen oder gar zu Gewalttaten. Zählt Kritik an der Politik Israels auch
dazu? Das hängt davon ab, wie die Kritik ausfällt.
Ich selbst kritisiere die israelische Regierung und die Israelis tun es
auch. Das ist ein Merkmal eines demokratischen Staates. Allerdings müssen
wir zwischen Kritik und Hass unterscheiden, zwischen Kritik also und jenen
Erscheinungen, die eine Gesellschaft gefährden. Im Moment gibt es im Hinblick
auf Israel beides. Es gibt Befürchtungen, dass der Antisemitismus
nach dem EU-Beitritt der osteuropäischen Staaten zunehmen wird. Fürchten
Sie das auch? Nach meinen Reisen in den Osten bin ich
besorgt, empfinde aber keine Furcht. EU-Kommissionspräsident Romano Prodi
hat uns versprochen, antisemitische Entwicklungen in den neuen Mitgliedsstaaten
genau zu beobachten. Das Gespräch führten Damir Fras und Alexander
Mäder. |
Mittwoch, 28. April 2004
Von Helmut Breuer und Gernot Facius
Berlin - In Berlin findet von heute an die Internationale Antisemitismus-Konferenz der 55 OSZE-Staaten statt. Aus diesem Anlass sprach die Berliner Morgenpost mit Paul Spiegel, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, der auch auf der Konferenz sprechen wird.
Berliner Morgenpost:
Herr Spiegel, was ist Ihre Botschaft an diese Konferenz, und was erwarten Sie?
Paul Spiegel: Was Antisemitismus ist, sollten eigentlich alle wissen. Gleichwohl habe ich den Eindruck, dass viele etwas zu bekämpfen versuchen, was sie nicht verstanden haben. Die Hohmann-Rede oder die aktuelle Diskussion um vermeintliche Tabus bei der Israel-Kritik im Nahost-Konflikt zeigen dies. Die Frage, die in Berlin zu beantworten ist, lautet: Wie können wir dem wachsenden globalen Antisemitismus begegnen? Es hat ja schon verschiedene Konferenzen und Seminare gegeben. Bisher ist es immer bei Absichtserklärungen geblieben; schöne Reden und Deklarationen, die verstauben. Von der Berliner Konferenz erhoffe ich mir, dass die dort gesetzten Akzente die tägliche Arbeit der Regierungen beeinflussen. Aber auch die Zivilgesellschaften müssen erkennen, dass sie betroffen sind. Antisemitismus als Form des Rassismus ist Menschenfeindlichkeit. Die geht uns alle an und bedroht die Fundamente der Demokratie.
Rechnen Sie damit, dass in der
größer werdenden Europäischen Union auch der Antisemitismus wächst?
Die Erfahrungen der letzten Wochen und Monate lassen Schlimmes befürchten. In einigen osteuropäischen Ländern sind der Antisemitismus und vor allem der Antijudaismus noch sehr ausgeprägt. Das ist ein großes Problem für die wachsende EU. Doch gerade deswegen ist die Berliner Konferenz, bei der ja 55 Länder vertreten sind, wichtig. Wir brauchen Foren, um über Grenzen hinweg öffentlich zu diskutieren und Kräfte im Kampf gegen den Antisemitismus auch in Osteuropa zu mobilisieren. Antisemitismus beruht auf Klischees und Vorurteilen. Nur Aufklärung kann hier wirksam helfen.
Was sagen Sie auf der Konferenz
zu Deutschland?
Die Lage in Deutschland ist nicht schlechter als anderswo. In einzelnen Fällen sicherlich sogar besser. Beispiel Frankreich. Ja, die staatlichen Institutionen in Deutschland sind auf Grund der historischen Ereignisse besonders sensibel. Gleichwohl gibt es keine Entwarnung für Deutschland. Die Zahl der latenten Antisemiten liegt konstant bei 15 bis 20 Prozent. Sorgen machen mir die 80 Prozent der schweigenden, unentschlossenen Mehrheit. Zwar ist die Zahl derjenigen, die einen Juden nicht zum Nachbarn haben wollen, von 23 auf 18,4 Prozent zurückgegangen. Aber die Zahl derjenigen, die glaubt, dass Juden den Holocaust instrumentalisieren, stieg im gleichen Zeitraum von 48,3 auf 63,7 Prozent. Auch die Gewaltbereitschaft hat erheblich zugenommen. Der Antisemitismus ist nicht mehr länger ein Problem der "Schmuddelecken", sondern findet sich sogar in den Kreisen der Eliten. Antisemitische Briefe und E-Mails, die wir heute bekommen, tragen durchweg die richtigen Namen der Absender. Darunter finden sich auch solche mit akademischen Titeln. Trotzdem blicke ich optimistisch in die Zukunft.
Was meinen Sie konkret?
Vor allem die enorme Einwanderung von Juden nach Deutschland. Heute leben in Deutschland, wo bis 1933 rund 650 000 Juden registriert waren, wieder mehr als 100 000 Juden. Damit sind wir inzwischen die drittgrößte jüdische Gemeinschaft in Europa nach Frankreich und England. Und das ist ein riesiger Vertrauensbeweis. Es zeigt, dass diese Juden Vertrauen in dieses Land haben, dass sie gern in Deutschland leben. Rückschläge gibt es immer wieder. Doch Deutschland ist für viele Juden wieder Heimat geworden. Und unsere Kinder, die hier geboren werden, wachsen auf wie alle anderen auch und wollen ein Teil dieser Gesellschaft sein. Und auch die Mehrheit der deutschen Gesellschaft will offenbar, dass Juden wieder in Deutschland leben, dass es bei uns 83 jüdische Gemeinden gibt, dass neue Synagogen gebaut werden. Es gibt zwar immer noch eine gewisse Befangenheit zwischen Juden und Nichtjuden. Aber wir sind auf dem Weg zur Normalität.
Haben Sie Verständnis für das Urteil
von Daniel Goldhagen, der von einem im deutschen Volk wurzelnden, eliminatorischen
Antisemitismus gesprochen hat?
Ich teile die pauschalisierende Beurteilung Goldhagens nicht. Ich halte überhaupt nichts von Verallgemeinerungen. Es gibt nicht die Deutschen und auch nicht die Juden. Ich habe dafür kein Verständnis. Denn wenn ich diesen Eindruck oder auch nur ein solches Gefühl hätte, dann würde ich nicht in Deutschland leben. Und ich bin sicher, dann wären in den letzten Jahren auch nicht 70 000 Juden nach Deutschland gekommen.
Ist es nicht so, dass Antisemitismus
auch importiert wird? Zum Beispiel durch die Zuwanderung von Moslems?
Zunächst einmal sind nicht alle Moslems Antisemiten. Auch wenn viele islamistische Terroristen nicht nur uns, sondern der ganzen Welt das Leben schwer machen, warne ich vor einer kollektiven Verurteilung der Moslems. Die große Mehrheit der Moslems in Deutschland will gemeinsam mit allen anderen Religionsgemeinschaften oder auch Nichtreligiösen in friedlicher Nachbarschaft leben. Aber es ist richtig, und wir erleben das ja in Frankreich, dass der Antisemitismus immer stärker auch von zugewanderten Islamisten ausgeht. Wir beobachten mit Sorge, dass diese radikalen Islamisten auch in deutschen Moscheen ihr Unwesen treiben. Gleichwohl stehen wir in Kontakt mit einigen türkischen und moslemischen Organisationen.
Ist der Konflikt zwischen liberalen
Juden und dem Zentralrat ein Richtungsstreit?
Der Streit ist bekannt und findet im Übrigen weltweit statt. In Deutschland aber frage ich mich, wer in diesem Streit die liberale Seite und wer die orthodoxe vertritt. Der Zentralrat der Juden in Deutschland schreibt keiner Gemeinde ihre religiöse Ausrichtung vor. Wir sind ein politischer Dachverband. Das ist Sache jeder einzelnen Gemeinde selbst. Wir haben keine religiöse Definitionshoheit. Im Zentralrat sind Gemeinden organisiert wie beispielsweise Weiden in der Oberpfalz und Oldenburg. Dort stehen Frauen als Rabbiner an der religiösen Spitze der Gemeinde. Die Landesrabbiner von Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern sind beide liberal-progressive Rabbiner. Der Zentralrat fördert sowohl ein liberales Rabbinatsgericht wie auch ein orthodoxes. Wir schaffen die Rahmenbedingungen, in denen sich alle pluralistischen Richtungen des Judentums zu Hause fühlen können. Wer dies ignoriert, der will nicht anerkennen, dass der Zentralrat seit vielen Jahren längst liberales jüdisches Leben vertritt.
Mittwoch, 28. April 2004
taz: Antisemitismus wird in der Öffentlichkeit meist mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht. Trifft dies so zu?
Wolfgang Benz: Das trifft zu, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Antisemitische Manifestationen wie Friedhofsschändungen oder Attacken auf Personen gehen in der Regel auf rechtsextreme Antisemiten zurück. Aber ein viel größeres Feld ist der Alltags-Antisemitismus, also verdeckte Judenfeindschaft, die sich im Alltagsgespräch äußert. Dazu muss man überhaupt nicht rechtsextrem sein.
Von welchen Gruppen geht das aus?
Es geht quer durch alle Gruppen. Der Oberstudienrat kann genauso Judenfeind sein wie der Maurermeister oder der arbeitslose Hilfsarbeiter.
Dann ist das auch sicher nicht eine auf Deutschland beschränkte Erscheinung?
Keineswegs. Antisemitismus ist wohl das älteste soziale, politische, kulturelle Vorurteil, das wir kennen. Es ist so ziemlich weltweit verbreitet. In Deutschland ist das Problem übrigens gar nicht so alarmierend wie in manchen anderen Ländern.
Beispiel?
Osteuropa. In den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, aber auch in Polen gibt es einen virulenten Antisemitismus, der dort salonfähiger ist als in Deutschland. In Frankreich, Belgien und den Niederlanden gibt es einen anderen Antisemitismus. Er geht von jungen islamischen Einwanderern aus Arabien und Nordafrika aus, die sich vehement als Judenfeinde artikulieren.
Könnte man das nicht einfach auch als religiösen Antagonismus bezeichnen?
Antisemitismus ist der Oberbegriff für jede Form von Judenfeindschaft. Die älteste Form ist der religiös motivierte Antijudaismus, der in unserer säkularisierten Gesellschaft keine große Rolle spielt. Dann gibt es den so genannten modernen Antisemitismus, das ist die pseudowissenschaftlich mit der Rassenlehre argumentierende Judenfeindschaft, die von Hitler praktiziert wurde. Die dritte Form ist der Antizionismus als Kampfbegriff nicht nur gegen den Staat Israel, sondern fast immer gegen die Juden als Kollektiv. Und es gibt viertens einen sekundären Antisemitismus: Das ist eine neue Judenfeindschaft in Deutschland, die nicht trotz, sondern wegen Auschwitz funktioniert, also eine Abneigung gegen Juden, weil sie uns an deutsche Verbrechen erinnern, weil Wiedergutmachungszahlungen geleistet wurden, weil sie uns daran hindern, den Schlussstrich zu ziehen.
Wo ist die Grenze zwischen legitimer Israelkritik und Antisemitismus?
Die legitime Israelkritik richtet sich gegen einzelne politische Maßnahmen der derzeitigen israelischen Regierung und kritisiert sie mit Argumenten, weil sie beispielsweise erkennbar nicht zum Frieden führen können, weil sie die Gewaltspirale immer wieder neu beschleunigen. Wenn aber die Israelkritik umschlägt in eine Verallgemeinerung, die sagt, die Juden sind eben so - "Auge um Auge, Zahn um Zahn" - und weil das Juden sind, benehmen sie sich so, dann ist das keine Israelkritik mehr, sondern Antisemitismus.
Deutschland ist heute und morgen Gastgeber der OSZE-Konferenz über Antisemitismus. Was kann eine solche Konferenz leisten?
Diese Konferenz, auf der 55 Staaten vertreten sein werden, kann nicht viel mehr leisten als eine feierliche Verurteilung des Antisemitismus. An konkreten Schritten wird eine solche Konferenz ziemlich wenig bewirken. Sie kann aber darauf dringen, dass in den einzelnen Mitgliedsländern Aufklärung verbessert werden soll, dass etwa weißrussische oder ukrainische oder aserbaidschanische Schülerinnen und Schüler besser über Antisemitismus und seine Folgen, die Völkermord sein können, informiert werden.
Das ist nicht gerade eine überragende Funktion …
… aber eine wichtige. Sie
sendet an gegenüber dem Antisemitismus weniger aufgeklärte Länder wie Weißrussland,
Russland, die baltischen Länder und Polen ein Signal: Es gibt eine Verabredung
in Europa, die primitive Instrumentalisierungen von Vorurteilen wie Antisemitismus
ächtet - weil sie den Spielregeln unserer zivilisierten europäischen Gesellschaft
widersprechen.
INTERVIEW:
DETLEF RUDEL, AP
Donnerstag, 29. April 2004
Mit eindringlichen Aufrufen zum Kampf gegen Judenfeindlichkeit und Rassismus hat am Mittwoch in Berlin eine Konferenz gegen Antisemitismus begonnen. An dem zweitägigen Treffen nehmen mehr als 500 Teilnehmer aus allen 55 OSZE-Staaten teil.
Berlin - Aufwändige Sicherheitsmaßnahmen, die gleichwohl dezent blieben, schützten die etwa 500 Delegierten, die gestern zur Konferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ins Außenministerium nach Berlin gekommen waren. Die OSZE ist ein Produkt der Détente der frühen siebziger Jahre, als die Kontrahenten des Kalten Krieges zumindest auf europäischer Ebene ein wenig Vertrauensbildung zu betreiben begannen. Was sie beschließt, kann politisch, aber niemals rechtlich bindend sein. Sie ist, mit anderen Worten, das ideale Forum für eine Konferenz zum Thema Antisemitismus, bei der es vor allem um die Demonstration von Entschlossenheit und Übereinstimmung geht.
"Die OSZE", so sagte denn auch Bundespräsident Johannes Rau in seinem Grußwort, "versteht sich als eine Organisation, die Normen setzt. ... Niemand darf vor Rassismus, vor Fremdenfeindlichkeit und vor Antisemitismus die Augen verschließen. Wir sollten diese Begriffe aber nur dann benutzen, wenn sie wirklich die Sache treffen". Es sei ihm wichtig, so fügte der Bundespräsident hinzu, "dass wir uns öffentlich mit rassistischen und antisemitischen Vorurteilen auseinandersetzen. Sonst entsteht bei manchen der Eindruck, die inhaltliche Auseinandersetzung solle unterdrückt werden."
Gerüchten zufolge war die ausschließliche Konzentration auf den Antisemitismus im Vorfeld der Tagung durchaus umstritten gewesen. Viele Delegierte hätten das Spektrum gern, wie es in der Rede des Bundespräsidenten anklang, auf Rassismus und Bürgerrechte erweitert. Aber nach Auffassung von Bundesaußenminister Joschka Fischer legt gerade der Tagungsort Berlin die Beschränkung auf den Antisemitismus nahe: "Die Bundesregierung", so Fischer, "hat Sie alle zu dieser Konferenz nach Berlin eingeladen - in die Stadt, in der vor beinahe 70 Jahren nicht weit von hier die Vernichtung des europäischen Judentums beschlossen, geplant und ins Werk gesetzt wurde." Fischer, der auch mit US-Außenminister Colin Powell, seinem spanischen Amtskollegen Moratinos und dem israelischen Staatspräsidenten Moshe Katzav zusammentraf, betonte, Antisemitismus sei nicht nur ein Problem der Politik, und schon gar nicht nur ein Problem der Juden. "Jeder tätliche Angriff gegen einen jüdischen Bürger, jede Schändung eines jüdischen Friedhofs, ja, jede einzelne antisemitische Äußerung bedroht nicht nur jüdische Menschen, sondern auch und gerade unsere offene und demokratische Gesellschaft als Ganzes." Mit den Grußworten von Elie Wiesel und Simone Veil, zweier prominenter Überlebender des Holocaust, stand die Veranstaltung fast zwangsläufig unter dem Banner des "Nie Wieder", noch bevor die Hintergründe der aktuellen Formen des Antisemitismus - speziell des islamistischen - noch annähernd ausgeleuchtet waren. Zwar warnte Paul Spiegel, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, es dürfe im Kampf gegen den Antisemitismus nicht zu einem "Anti-Islamismus" kommen. Und Wiesel stellte die Frage, warum eigentlich kein einziger Muslim auf den Podien vertreten sei (Kooperationspartner aus arabischen Ländern sowie aus Israel saßen im Plenarsaal). Naturgemäß wurden große Erwartungen an die Möglichkeiten staatlicher Bekämpfung des Judenhasses gesetzt: Aufnahme in die Verfassung, Erlass expliziter Gesetze, Bildungsoffensiven. Die Diskussion darüber, wann der Kampf gegen Antisemitismus mit der Meinungsfreiheit in Konflikt gerät, gehört zu den vielen Fragen, die die Tagung offen ließ. BM
Konferenz im Netz:
Mehr Informationen im Internet: www.osce.org/events
Donnerstag,
29. April 2004
„Unterricht zum Holocaust ist oft schräg“
Antisemitismus im Klassenzimmer – was kann man dagegen tun? Der Pädagoge
Bernd Fechler weiß Rat
BERND FECHLER (40)
ist Diplompädagoge und Bildungsreferent der Jugendbegegnungsstätte Anne Frank
in Frankfurt am Main.
Foto: Oliver Wolters
Herr Fechler, wie äußert sich Antisemitismus im Klassenzimmer?
Neuerdings verbreitet sich das Schimpfwort „du Jude“. Lehrer, die zum
ersten Mal in ihrer Laufbahn mit diesem Tabubruch konfrontiert werden, sind
schockiert. „Die Juden sind schuld“ – in dieses Statement münden immer wieder
politische Diskussionen zwischen Schülern und Lehrern, am häufigsten dann, wenn
es um die Lage in den palästinensischen Gebieten geht. Die israelische Besatzungspolitik
wird mit den Methoden der Nazis verglichen. Die Jugendlichen sagen dann „Scharon
ist wie Hitler“.
Stammen diese Schüler aus muslimischen Familien, die ja nach letzten Studien
für den neuen Antisemitismus in Europa stark mitverantwortlich sind?
Antisemitismus ist in islamisch-arabischen Ländern tatsächlich weit
verbreitet. In welchem Ausmaß dieser über Satelliten-TV und Internet in die
Köpfe und Herzen junger Migranten Eingang findet – darüber wissen wir leider
noch viel zu wenig. Einseitige Schuldzuweisungen für die sehr komplexe Situation
im Nahen Osten sind aber auch unter deutschen Jugendlichen beliebt – und nicht
selten auch unter Erwachsenen. Manche Globalisierungsgegner etwa verrennen sich
in Verschwörungstheorien zum 11. September, glauben, dass der israelische Geheimdienst
hinter den Anschlägen steckte und jüdische Arbeitnehmer im World Trade Center
gewarnt worden wären. Mit Schülern, deren Eltern selber aus arabischen Staaten
stammen, eskalieren die Diskussionen allerdings leicht. Mir hat schon ein junger
Migrant entgegengeschleudert: „Ich hasse alle Juden, ich hasse sie.“ Von einem
deutschen Pädagogen, der in seinen Augen „sowieso keine Ahnung hat, weil er
für die Juden ist“, wollte er sich keine Argumente mehr anhören.
Was bedeutet es, wenn sich Schüler gegenseitig als „Jude“ oder als „Opfer“
beschimpfen?
Wenn beide Begriffe synonym verwendet werden, ist das perfide. „Jude“
wird hier auf „Opfer“ reduziert und gleichzeitig verhöhnt. „Opfer“ steht für
Schwächling, Weichei. Jemanden als „Opfer“ zu beschimpfen, heißt aber auch,
dass man selber keines sein will: Ich bin kein Fall für den Sozialarbeiter,
ich mache mein Ding, kann auch Täter sein und mich an der Gesellschaft rächen,
die mich benachteiligt.
Wie sollten Pädagogen auf diese Schimpfworte reagieren?
Sie sollten die Jugendlichen fragen: Was meinst du damit? Es kann auch
eine Konkurrenz der Opfer dahinter stehen, dass etwa junge Migranten auf ihre
Diskriminierung hierzulande aufmerksam machen wollen. Problematisch wird es,
wenn es dann heißt: „Die Palästinenser sind die ‚Juden’ der Juden.“ Dann muss
sich der Lehrer die Zeit nehmen, mit der ganzen Klasse oder im Einzelgespräch
den Unterschied zwischen dem Holocaust und der Gewalt zwischen Palästinensern
und Israelis zu erklären, und dabei auch die Verantwortung der radikalen Palästinenser
nicht unterschlagen. Wir müssen die Schüler in ihrer Empörung über ungerechte
Verhältnisse ernst nehmen, aber die Argumentation in Frage stellen, wo es nötig
ist.
Also alles ausdiskutieren?
Ja, aber es gibt auch Punkte, an denen wir die Diskussion abbrechen
und sagen: so nicht. Wenn platte antijüdische Vorurteile provokativ wiederholt
werden oder wenn die Jugendlichen etwa behaupten, dass Hitler es richtig gemacht
habe mit der Verfolgung der Juden.
Hat denn die „Erziehung nach Auschwitz“, die seit mindestens einem Vierteljahrhundert
den Geschichtsunterricht in Deutschland prägt, gar nichts gebracht?
Dass wir noch immer die Probleme haben, muss nicht heißen, dass die
Programme sinnlos waren. Unterricht zum Holocaust kann Jugendliche für die Gefahren
des Antisemitismus sensibilisieren, aber niemanden dagegen „immunisieren“. Nicht
selten wird dieses Thema jedoch schräg inszeniert. Schüler wehren sich gegen
einen moralisierenden Unterton ihrer Lehrer. Sie mögen es nicht, wenn das Thema
nicht offen behandelt wird, wenn sie schon vorher wissen, was der Lehrer hören
will.
Also doch eine Bankrotterklärung?
Nein, historisches Wissen über den Nationalsozialismus bleibt sehr wichtig,
und auch Schüler von heute können aus der Geschichte lernen. Es gibt ja Gedenkstätten,
die gute Workshops anbieten, wie das Haus der Wannseekonferenz in Berlin. Da
können zum Beispiel Berufsschüler einen Workshop über die Verstrickung ihres
Berufsstandes in den NS und die Judenverfolgung mitmachen. Sie haben die Chance,
Geschichte als etwas wahrzunehmen, das sie persönlich interessiert. Täter, Opfer
und Helfer – das ist auch auf Situationen übertragbar, die sie kennen. Warum
schauten so viele zu? Aber die aktuellen Probleme von Rassismus und Diskriminierung
kann man nicht mit Unterricht zum Holocaust lösen.
Was also können Lehrer da tun?
Leider ignorieren viele Pädagogen diese Probleme. Sie sagen: „Ich habe
zwar viele Ausländer in der Klasse, aber für mich sind alle Menschen gleich.“
Sie müssen sich endlich in den aktuellen Debatten über Migration orientieren
und die spezifischen sozialen Probleme ihrer Schüler wahrnehmen. Und sie müssen
erkennen, dass Schüler in multikulturellen Schulklassen die Geschichte des Holocaust
aus ganz unterschiedlichen Perspektiven wahrnehmen. Auf antisemitische Äußerungen
adäquat reagieren kann nur ein Lehrer, der sich seiner selbst vergewissert hat:
Wie bin ich selbst durch Eltern und Großeltern geprägt, woher kommt zum Beispiel
meine Scheu, das Wort Jude auszusprechen?
Das Gespräch führte Amory Burchard.
Donnerstag, 29. April 2004
»Wer eine Minderheit
hasst...«
Elie Wiesel erhofft sich von der OSZE-Konferenz ein kräftiges Signal gegen
das »Gift des Antisemitismus«
Von
Jochen Reinert
Mit Simone Veil (Frankreich) und Elie Wiesel (USA) beschworen am ersten Tag
der OSZE-Konferenz gegen Antisemitismus zwei Überlebende des Holocaust die Regierungen
und Bevölkerungen der OSZE-Staaten, dem anwachsenden Judenhass konsequent zu
begegnen.
Viele der rund 600 Teilnehmer der OSZE-Konferenz mögen Simone Veil und Elie
Wiesel schon einmal bei der einen oder anderen Gelegenheit begegnet sein, doch
angesichts der Europa heimsuchenden Wogen von altem und neuem Antisemitismus
waren alle sehr gespannt auf ihre Botschaft. »Ich gehöre zu der traumatisierten
Generation, die den Antisemitismus in seiner apokalyptischen Form erlebt hat«,
sagte Elie Wiesel, der von Ungarn aus nach Auschwitz verschleppt wurde und die
Todesmaschinerie der SS als Zwangsarbeiter im Buna-Werk überlebte. »Es gibt
keine Hauptstadt der Welt, in der eine solche Konferenz bedeutungsvoller und
überzeugender wäre«, erklärte der Friedensnobelpreisträger. Das Treffen werde
just in der Stadt abgehalten, in der man ein Programm ausarbeitete, mit dem
versucht wurde, »auch den letzten Juden auf dieser Erde auszulöschen«.
Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg hätte Wiesel allerdings nie gedacht,
dass es in Europa wieder eine Zeit geben würde, in der Juden in Angst leben
müssten. Der Antisemitismus sei nicht nur für die Juden gefährlich, sondern
auch für die einzelnen Gesellschaften insgesamt. »Wer eine Minderheit hasst,
hasst alle Minderheiten«, konstatierte er.
Bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage, warum es diesen Hass gebe, ging
Wiesel auch auf den Jesus-Film des USA-Regisseurs Mel Gibson ein, vom dem er
glaube, dass er zu mehr Antisemitismus führen könne. Dies sei gerade deshalb
bedauerlich, weil die christlich-jüdischen Beziehungen noch nie so gut gewesen
seien wie heute. Wiesel erhofft sich von der Konferenz, dass von ihr ein kraftvolles
Signal gegen das »Gift des Antisemitismus« ausgehe.
Während Elie Wiesel seine Besorgnis über den offenen Antisemitismus in einigen
islamischen Staaten ausdrückte, wandte sich die französische Politikerin Simone
Veil dem Phänomen des wachsenden Antisemitismus unter muslimischen Emigranten
in Westeuropa zu. Simone Veil, die als Kind 13 Monate in den KZ Auschwitz und
Bergen-Belsen gequält wurde, erinnerte an die Welle von Gewalttaten gegen französische
Juden nach Beginn der 2. Intifada in Palästina. Neben dem traditionellen Antisemitismus
etwa in Gestalt der Leugnung des Holocaust gäbe es auch neue gefährliche Tendenzen
wie die Weigerung von Lehrern, in den Schulen über die Shoa zu sprechen. Sie
wertete es als ein Zeichen der Hoffnung, dass Präsident Jacques Chirac erklärte,
wer einen Juden attackiert, attackiere Frankreich.
Hier schloss der französische Abgeordnete Pierre Lellouche an, auf dessen Initiative
beide Kammern der Pariser Nationalversammlung am 3. Februar 2003 einstimmig
ein Gesetz annahmen, das bis dahin vorhandene Lücken in der Verfolgung antisemitischer
Straftaten abdeckte. Ausgangspunkt war die starke Zunahme antijüdischer Gewaltakte
von 119 im Jahre 2000 auf ein Vielfaches in den Jahren danach. Unterdessen sei
das neue Gesetz bereits 20 Mal angewendet worden. Lellouche glaubt, dass der
neue Antisemitismus im Wesentlichen aus dem Nahen Osten importiert wurde und
die dortigen Auseinandersetzungen widerspiegele. Deshalb regte er an, solche
Konferenzen sollten nicht nur in Europa, sondern auch in Kairo, Riad oder Amman
stattfinden.
»Es gibt keinen gefährlichen oder weniger gefährlichen Antisemitismus«, hatte
zuvor der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Paul Spiegel,
erklärt. Antisemitisch gefärbte Israelkritik »vermeintlicher Intellektueller«
sei ebenso wenig zu tolerieren, wie jene aus »den Kehlen verhetzter Islamisten«.
Für die Betroffenen mache es keinen Unterschied«, ob es sich bei antisemitischen
Tätern um Islamisten oder gewaltbereite Rechtsradikale handele. Zugleich warnte
Spiegel aber auch vor einem »neuen Anti-Islamismus«, der in Europa bereits erkennbar
sei. Die islamistische Gefahr dürfe nicht überbewertet werden.
Ein »großartiges Ergebnis« der OSZE-Konferenz, so Spiegel, wären »länderübergreifende
Initiativen« sowohl gegen rechten als auch islamistischen Antisemitismus sowie
eine Einigung auf eine systematische Beobachtung antisemitischer Tendenzen.
Gleichzeitig gab Spiegel zu bedenken, dass der Kampf gegen den Antisemitismus
mit der Osterweiterung der Europäischen Union »komplizierter und langwieriger«
werden könnte. In vielen der jetzt der EU beitretenden Länder seien die Verbrechen
der Kollaboration während der Zeit des Faschismus nur »ansatzweise« aufgearbeitet.
Aber nicht nur aus Frankreich wurden am ersten Tag der OSZE-Konferenz wichtige
Erfahrungen bei der Bekämpfung des Antisemitismus übermittelt. Vergleichbare
Bestrebungen gibt es etwa auch in Schweden, wo bereits 1998 eine bisher beispiellose
Kampagne zur Holocaust-Aufklärung gestartet wurde, in deren Verlauf eine Million
Broschüren über die Shoa an alle Schulen und Familien des Landes gesandt wurden;
dem folgte die Bildung einer internationalen Task Force zu diesem Thema. Auch
in Polen, so war zu erfahren, erschien am Vorabend der Konferenz ein Buch mit
Essays von 13 polnischen Autoren über die Notwendigkeit der Holocaust-Aufklärung
an den Schulen.