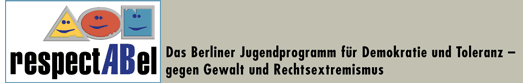
Pressespiegel | 15.02.2017
NDR: "Die Partei" plant Großes an "Führers Geburtstag"
Pressespiegel | 15.02.2017
: Den Nazi-Hipstern entgegentreten
News | 06.01.2013
Fördermittel für die politische Bildung stehen bereit
News | 04.01.2013
Internetangebot Präventionsnetz gegen Rechtsextremismus gestartet
Emo à la carte
Rubrik: Musik - Kunst - Kultur
Emo als neues Feindbild: Die Identität der Jugendkultur Emo resultiert aus Ablehnung und bietet eine perfekte Projektionsfläche bürgerlicher Ängste und Vorurteile: Ist die Emokratie gescheitert?
Von Moritz Wilken (22 Jahre, Rapper, Künstler und Redakteur des polli-magazins)
Skins und Punks gegen Hippies, Mods gegen Rocker, Metalheads gegen HipHopper - die Feindschaftsgeflechte zwischen Jugendkulturen sind üppig, teilweise undurchdringlich. Seit Jahren zieht nun eine noch relativ junge Jugendkultur die Feindschaft der meisten neuen und alten Jugendkulturen auf sich: Emo. Emo steht für tendenziell suizid-gefährdete, schwarz gekleidete, androgyne Kids, für verweichlichte Jungs in harten Zeiten, die sich ritzen und womöglich noch das Leben nehmen. „Emo“ bedeutet Ablehnung und Belächelung; ist die most hated Jugendkultur today.
Was ist Emo?
Was ist Emo? Die Ursprünge von Emo liegen zunächst im amerikanischen Ostküsten-Hardcore. Hardcore entstand aus dem Punk. Punk war den Protagonisten der Hardcore-Szene jedoch irgendwann zu versumpft, zu selbstzerstörerisch, auch zu langsam geworden. Es wurde nach einer neuen Radikalität gesucht. Die Härte der Musik machte das Genre jedoch schnell für ein Publikum und Bands interessant, die chauvinistisch und homophob waren: Kurt Cobain, Sänger von Nirvana, schrieb in seinen Tagebüchern, dass Hardcore etwas für Leute wurde, die „schon seit ihrer Zeit in der Ringermannschaft kurze Haare“ gehabt hätten. Gegen diesen Einfluss wehrten sich schließlich Bands wie Fugazi oder Rites of Spring, deren sozialkritischen und intimen Lieder bald als „Emotional Hardcore“ bezeichnet wurden, in Kurzform: „Emo“. Auch wenn diese Bands mit diesem Etikett nie besonders viel anfangen konnten oder wollten (ähnlich wie Mudhoney oder Alice in Chains mit dem Schlagwort „Grunge“), so werden sie doch bis heute als Ur-Väter dieses Musikgenres bezeichnet.
Das alte Emo: Liebe und Verzweiflung, sehnsüchtiges Anbeten der Geliebten und ein bisschen Sozialkritik
Emo, das stand für Liebe und Verzweiflung, sehnsüchtiges (und vergebliches Anbeten) der Geliebten, ein bisschen Sozialkritik, kombiniert mit relativ harter Musik und Sing-Schrei-Passagen. Zu Beginn der 1990er Jahre legte schließlich Moss Icon den Stil des Genres Emo für die nächsten 15 Jahre fest, er war aber keinen Feindschaften ausgesetzt. Auch in Deutschland entwickelte sich in Städten wie im beschaulichen Göttingen eine Emo-Szene: Bands wie Katzenstreik und El Mariachi begannen mit kleineren Kassetten- und Vinyl-Auflagen auf sich aufmerksam zu machen. Ende der 1990er wurden dann zunehmend die Spielarten der „zweiten Welle“ übernommen; Mitte der 2000er war der Begriff schließlich einer breiten Masse bekannt. Allerdings ging es jetzt statt um Bands wie Fugazi und einem Sänger, dessen Namen man immer gerne mit „Pinocchio“ aussprechen will, um Autoaggression, verweichlichte Jugendliche und Totenkopf-Accesoirs.
Das neue Emo: Homophobie, Neid und Plagiatsvorwürfe
Heute ist Emo das neue Feindbild. Es heißt, Emos würden sich ritzen, das betont Emotionale wird abgelehnt und als „schwul“ abgestempelt. Viele sprechen Emo sogar gänzlich das Recht ab, eine Jugendkultur zu sein. Gerade im Zuge des Internets kristallisierte sich in den letzten Jahren eine Szene heraus, deren Mitglieder man entweder vorher nie gesehen hatte oder eben nie als „Emos“ ansah; Mitglieder artverwandter Szenen wie Punk oder Gothic reagierten irritiert auf den Hype, der im Internet grassierte. Es war, als sei eine ganze Szene entstanden, von der vorher niemand gewusst hatte. Eine Mischung aus Halbwissen und Vorurteilen ergoss sich plötzlich über diese „neue“ Kultur.
Woher kommt der Hass auf Emo?
Warum aber die ganze Ablehnung? Die Gründe mögen verschieden sein, vor allem liegt dem Hass auf Emo aber eine tief verwurzelte Homophobie zu Grunde, das Weibliche im Männlichen wird abgewehrt. In Tracks wie „Emo Diss“ wird die angebliche Uniformität der Emos thematisiert, der Großteil der Punchlines bezieht sich auf eine „verstörte Jugend“, in der „Jungs sich nicht für Jungssachen interessieren!“ Insbesondere HipHopper oder Metalheads betiteln Emos heute damit, „schwul“ zu sein. Zudem scheinen Plagiatsvorwürfe und ein unbestimmtes Neidgefühl bei vielen männlichen Emo-Feinden Hassgefühle auszulösen: Punks und Gothics werfen den Emos vor, dass sie sich schamlos an ihren Codes bedient hätten. Außerdem wird von dieser Seite oft vorgeworfen, dass sie nur „Konsum-Kiddies“ seien, also, dass sie sich ihre Kleidung nicht nach dem alten D.I.Y-Gedanken selbst gestaltet hätten, sondern bereits fertig zerschlissen bei H&M kauften. Schließlich finden heute auch viele „normale“ Mädchen Gefallen am Aussehen und Habitus der Emo-Boys: Bestes Beispiel dafür ist die Verehrung vieler junger Mädchen für den Sänger der Pop-Band Tokio Hotel Bill Kaulitz. Der Sänger wurde, durch kluge Consulting-Menschen seines Labels, mit einem durchdachten Outfit mit Emo-Touch ausgestattet, welches bei den weiblichen Fans einen hohen Grad (sexueller) Hysterie auslöste.
Emo als perfekte Projektionsfläche bürgerlicher Ängste
Emo ist heute eine wachsende Szene, von der ein Journalist wie Kai Diekmann nur wissen musste, dass es unter ihnen Menschen mit autoaggressiven Störungen gab. Emo bietet heute eine perfekte Projektionsfläche bürgerlicher Ängste und Vorurteile, und so war das Bild der Emos in den Medien schnell geformt: Ziemlich weinerliche Typen, die sich die Arme aufritzen und vom Sterben träumen (außerdem ist es gut vorstellbar, dass in einem Journalisten im Kai Diekmann-Format die Lolita’esken Bilder einiger Emo-Girls den Humbert Humbert in ihm wecken). Stimmung wurde zudem im bürgerlichen Lager gemacht: Große Boulevard-Medien nahmen den Auftrag „besorgter Mütter“ an und berichteten über das „Emo-Phänomen“, weches dazu führen würde, dass sich junge Menschen die Arme aufschneiden und den Tod herbeiwünschen. Beinahe schon legendär in diesem Zusammenhang ist der Bericht des RTL-Magazins „Explosiv“: In einem Paradebeispiel für mangelnde Recherche und Unverständnis wurde die „Emo-Bewegung“ unter Generalverdacht gestellt, soziopathische Borderline-Patienten anzuziehen. Als Beweismittel dafür dienten Blogeinträge und Kunstblutfotos, die in der Reportage, unmittelbar mit dem Tod eines Jugendlichen zusammenhingen. Die Emos wurden unmittelbar mit Satanisten verglichen.
Selbstverletzendes Verhalten ist nicht gleich Emo
Wenngleich vieles davon wahr sein mag, ist das meiste hausgemachter Schwachsinn. Der Vorwurf, die Emo-Kids hätten sich ihren Stil aus Versatzstücken des Punk und der Gothic-Szene zusammen gestohlen, mag zwar an sich stimmen, ist aber in etwa so, als würden sich Vampire aus dem 19. Jahrhundert darüber beschweren, dass die Gothic-Kultur ein Plagiat ihrer selbst sei - jugendkulturelle Codes setzen sich schon immer mit Vorliebe aus schon Dagewesenem zusammen. Auch sind ritzende, selbstverletzende Jugendliche weder neu, noch eine Erscheinung der Emo-Kultur: Schon vor dem medialen Hype um ritzende Emos gab es junge Menschen, die sich selbst verletzten, es waren Punks, HipHopper oder „ganz normale Jugendliche“. Durch die Emo-Szene wurde und wird es allerdings für die Medien heute einfacher, selbstverletzendes Verhalten zu erklären, deren eigentliche Gründe jedoch psychologischer Aufarbeitung bedürfen und auf keine dümmliche Zeigefinger-Moral reduziert werden können.
Gewaltsame Auseinandersetzung mit Emos und Debatten um ein „Emo-Verbot“
Den Zeigefinger muss man woanders ansetzen, denn mittlerweile kommt es in globalen Zentren und Städten zu (gewaltsamen) Auseinandersetzung zwischen Emos und jungen türkischen oder arabischen Migranten, die nicht jugendkulturell organisiert sind. Auch hier ist der Grund eine verwurzelte Homophobie und ein „Machismo“, der es verhindert, offen über Gefühle sprechen zu können, die daraus folgende Irritation schlägt oftmals in Gewalttätigkeiten um. Wobei es den Emos in Westeuropa und Nordamerika noch verhältnismäßig gut geht: In Russland debattiert man mittlerweile ernsthaft über ein „Emo-Verbot“. Die „Emo-Szene“ wird dort dermaßen verteufelt, dass die Emos mit ihrem Ansehen irgendwo zwischen Boneheads und Satanisten pendeln. Russische Duma-Abgeordnete nannten die Emos sogar eine „schwere ethische und geistige Krise der russischen Jugend“ und prophezeiten, dass verfrühter Sex und Drogenmissbrauch mit der Jugendbewegung einhergehen würden.
In Süd- und Mittelamerika wiederum mehren sich Hetzjagden auf Emos, bei denen es schon wunderlich ist, dass es noch keine Toten gab. Die Feindschaft gegen die Emos kommt im Vergleich zu Russland hier nicht von oben, dort schlägt den Emos der Hass auf Augenhöhe entgegen: Skater, Metalfans, HipHopper und Punks veranstalteten dort schon des Öfteren heftige Hetzjagden auf Emos. Bei Demos betroffener Emos kam es zu Verletzten auf beiden Seiten. Auch hier ist es der lateinamerikanische Machismo, der den Emos zum Verhängnis wird. Sie seien „schwul“, wird in den Foren berichtet, die Frauen widersprechen oftmals gängigen Rollenklischees, was im erzkatholischen Mexiko wiederum Befremden auslöst.
Von Emo bis Porno
Was auf der einen Seite heute für Bekämpfung von Gefühlen, selbst auferlegte Zwänge und Debatten um Verbote steht, ist auf der anderen Seite Teil der Massenindustrie und Abbild sexualisierter Freiheit: Mittlerweile wimmelt es im Internet nur so von Pornoseiten, die ausschließlich „Emo-Mädchen“ abbilden, schwer vorstellbar, dass nur Emos solche Seiten aufsuchen. Der Reiz bei diesen Abbildungen besteht für die meisten aus dem Kontrast zwischen einer mädchenhaften Aura und sexuell eindeutigen Posen oder aber übersexualisierter Kleidung. Um das devot-mädchenhafte zu unterstreichen, werden heute oftmals asiatische Mädchen in ein solches Emo-Outfit gesteckt. Auch diese Tatsache bietet, gerade den Emo-Gegnern aus dem bürgerlich-konservativen Lager (wie in Russland) viel Reibungsfläche, weil diese die Bilder und Videos aus dem Internet für einen handfesten Beweis für ebendiese „sexuell verfrühte Handlungen“ hält.
Der Emo-Boom innerhalb der Pornoindustrie bleibt dabei ein Phänomen: Keine andere Jugendkultur/-szene wurde und wird heute in diesem Geschäftsfeld so sehr verwurstelt wie die Emos. Wo Emo ist, da ist nicht nur Hass und Verzweiflung; vielmehr resultiert die Identität der Jugendkultur Emo aus Ablehnung und Vermarktung zugleich. Und die Pornoindustrie ist heute tatsächlich noch der einzige Kosmos, in dem die Emos außerhalb ihrer eigenen Szene noch glorifiziert werden können.
Verantwortlich für den Inhalt dieses Textes: wannseeFORUM Berlin